Die neue Lust am Detail
- annekathrin kohout

- 21. Dez. 2016
- 5 Min. Lesezeit
Dieser Beitrag wurde zuerst auf der ehemaligen Website von art – Das Kunstmagazin veröffentlicht.
So manch einer, der sich in Dresden Raffaels berühmte Engel im Original ansehen will, dürfte überrascht sein, dass sie kein vollwertiges Gemälde füllen, sondern nur das kleine Detail einer großen Madonna sind. Wie aber kann es sein, dass der Ausschnitt so viel berühmter wurde als das Ganze? Annekathrin Kohout erzählt die Geschichte der Bild-Details.
Das beliebteste Detail der Kunstgeschichte feiert jedes Jahr zu Weihnachten sein Comeback: Raffaels Engel. Und weil ich viele Jahre in Dresden gewohnt habe, weiß ich, dass sie dort nicht nur zu Hause sind, sondern auch die Evergreens im Stadttourismus. Fängt man in Dresden an, nach den Putten Ausschau zu halten, begegnen sie einem schlichtweg überall. Nicht nur auf Postkarten: Sie werben für Biokäse, Schuhcreme oder Medikamente, für Süßes wie für Alkoholisches. Ja, man könnte sogar behaupten, dass diese beiden Engel ein frühes und analoges Mem sind. Denn bereits im 19. Jahrhundert schmückten die Putten so ziemlich alles, was eine Illustration zuließ: von Spruchkarten bis zu sogenannten "Ofenrohrbildern", die im Sommer in die Löcher für den Anschluss gelegt wurden. Ersichtlich wird das aus der Rezeptionsgeschichte von Raffael Santis "Sixtinischer Madonna", der die Engel entstammen. Diese Rezeptionsgeschichte ist aus zweierlei Hinsicht interessant. Zum einen, weil sich bei keinem anderen Bild der Rollenwechsel von einem kirchlichen Kultbild zu einem musealen Kunstwerk so explizit verfolgen lässt. Andererseits weil es zwei voneinander nahezu völlig unabhängige Rezeptionsstränge besitzt. Während die Madonna mit Kind mehrheitlich auf einen intellektuellen und elitären Resonanzraum stieß – nachdem sie Johann Joachim Winckelmann in seinen "Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst" 1756 schlagartig berühmt machte –, erlebten die beiden Engel als Detail und völlig losgelöst vom Gesamtbild ihre popkulturelle Rezeption. Eine
einzigartige
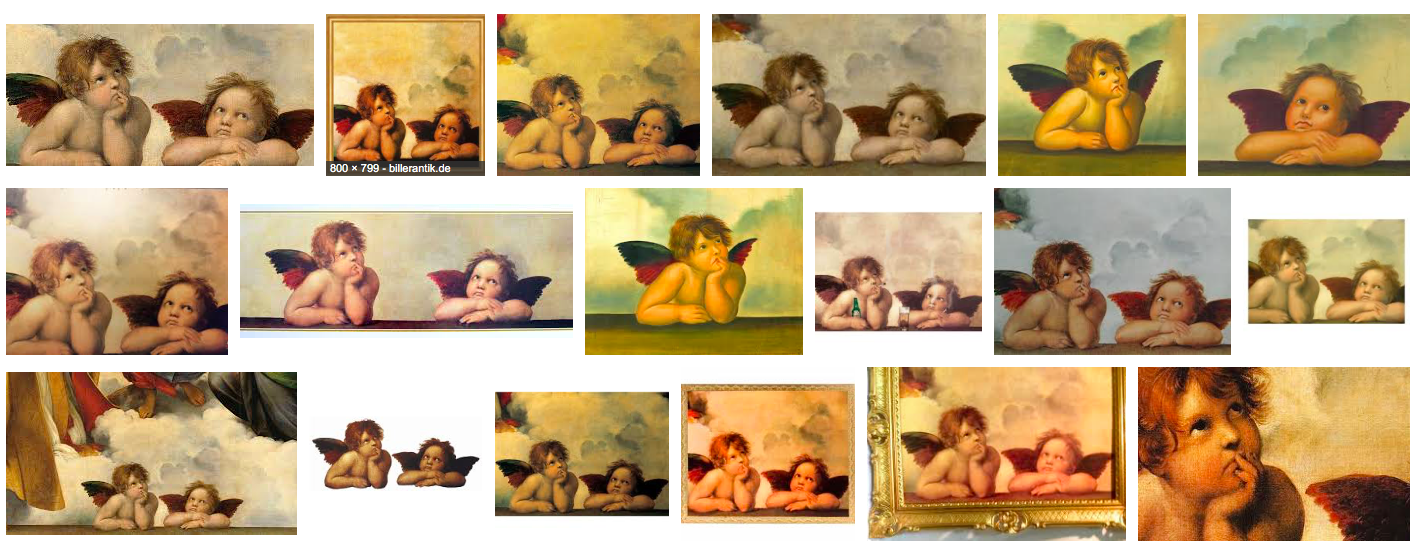
Die Karriere von Raffaels Engeln begann, nachdem der Maler August von der Embde sie erstmalig separat von dem restlichen Bild kopierte. Das war 1803, und zu dieser Zeit gab es einen regelrechten Kopisten-Boom, dem die Museen Einheit zu gebieten versuchten. So kam es zur ersten eigenständigen Karriere des Details in der Kunst. Denn die Erlaubnis für eine ganze Kopie war schwer zu erhalten und das Kopieren aufwendig. Teilkopien, die lediglich Details aus einem Werk reproduzierten, waren hingegen
schnell
Auf das Kunstwerk, dem die Details entnommen wurden, hat man dabei wenig Rücksicht genommen. Dass dieses durch die Popularisierung effektvoller Details in den Hintergrund rücken könnte, störte offenbar nur wenige. Dabei waren Teilkopien zur Herstellung von
neuen
Bevor im Zuge der
Moderne
Das passende Detail für jede Gelegenheit
Hätte mir zu Studienzeiten jemand erzählt, dass ich irgendwann am liebsten deshalb ins Museum gehen würde, um dort nach interessanten bis lustigen Details für Instagram-Bilder Ausschau zu halten – ich hätte ihm
sicher
Dass ich damit keinesfalls allein bin, wird spätestens deutlich, wenn man durch die Bilder scrollt, die etwa unter dem Hashtag der jeweiligen Museen aufgerufen werden. Da sieht man selten ganze Ansichten von bedeutenden Werken, etwa von Lukas Cranach, Rembrandt oder Picasso. Da sieht man Details! Ein Baby, das an den Eutern einer Ziege saugt, oder eine irre Flechtfrisur. Ganz zu schweigen von den abgedrehten Szenen, die in den Werken von Hieronymus Boschgefunden und anschließend gepostet werden. Überhaupt sind die Werke Boschs eine unerschöpfliche Quelle für Absurditäten und Entdeckungen. Unter den zahlreichen Einträgen, die man mit der Eingabe seines Namens auf Instagram, Tumblr und Pinterest findet, sind daher nicht zufällig meistens nur Details seiner Bilder.
Im Social Web kursieren überall Bildausschnitte. Das ist manchmal einer Notwendigkeit geschuldet – zum Beispiel wenn ein Bild auf das quadratische Format von Instagram angepasst wird oder eine Zensur vermieden werden soll, indem man intime Stellen einfach abschneidet –, oft aber Resultat einer bewussten Suche nach interessanten Bildstellen. Letzteres machen auch Museen oder Museumsbesucher, die mit der Entdeckung spannender Bilddetails Interesse an einer Ausstellung wecken oder einfach ihren guten Blick für Ungewöhnliches, Lustiges oder Aufregendes unter Beweis stellen möchten. Oft spielt es keine Rolle für die Jäger und Sammler, ob die Details einem Bild aus dem kunsthistorischen Kanon oder völlig unbekannten Kunstwerken entstammen. Besonders dann nicht, wenn das Augenmerk auf etwas ganz Spezifisches wie eine Pose oder eine spezielle Kleidung gelegt wird. Auf dem Instagram-Account "artandjewellery_" sammelt zum Beispiel ein Schmuckliebhaber Detailaufnahmen von schönen Perlenketten oder Edelsteinen. Bei "jardiniersdart" gibt es nur Ausschnitte, in denen ein Mann eine Pflanze sinnlich berührt. Und "artgarments" zeigt auf seinem Profil Partien besonderer Stoffe und Kleider.
So erlebt das Beschneiden von Kunstwerken, das Erzeugen von Teilkopien – wenn auch nicht materiell, sondern digital – gerade eine Renaissance. Galt es im letzten Jahrhundert als Ikonoklasmus, Kunstwerke zu beschneiden, ist es heute eine beliebte Alltagspraxis. Oft werden sie zum Ausgangspunkt anonymer Internet-Meme oder Gifs. Nun könnte man meinen, dass die sozialen Medien die Bildbetrachtung damit revolutioniert und vor allem demokratisiert hätten, schauen sich doch auch Menschen jenseits des Bildungsbürgertums nun die Kunst einmal richtig genau – nämlich detailgenau – an. Nur ist das, wie schon beim populären Vorläufer, Raffaels Putten, nicht wirklich der Fall: So folgenlos die Popularisierung für die intellektuelle Rezeption der Sixtinischen Madonna blieb, so wenig lernt man von dem lustigen Detail aus einem Gemälde von Hieronymus Bosch über das vollständige Bild.
Humorvoll, klug und anti-elitär
Doch erfrischend sind die Details allemal, und es lässt sich kaum bestreiten, dass sie auch lehrreich sein können. Schließlich plädieren sie für Perspektivwechsel, erkennen subjektive Sichtweisen an und entlarven in dem ehedem radikalen Schritt des Beschneidens die Kunstbetrachtung als elitär und eingeschränkt. Mit dem Detail erobern sich die Menschen also die Kunst aus der intellektuellen Auseinandersetzung zurück – die andächtig und mit Hemmungen vorm Falschliegen belegt war. Dabei inszenieren sie sich als individuelle Betrachter. Und das geschieht oft auf eine humorvolle bis unverhofft kluge Art. Denn indem Ausschnitte der alten Bilder in aktuelle Kontexte gestellt werden, erkennt man sie als Indikatoren für etwas Überzeitliches an.
In diesem anti-elitären Gestus besteht der Spaß am Detail.


Kommentare